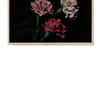Gräbersuche-Online
Gräbersuche-Online
Johann Reb
Geburtsdatum 29.04.1913
Geburtsort -
Todes-/Vermisstendatum 26.10.1942
Todes-/Vermisstenort -
Dienstgrad Obergefreiter
Johann Reb ruht auf der Kriegsgräberstätte in El Alamein .
Endgrablage: Gruft 1
- Name und die persönlichen Daten von Johann Reb sind auch im Gedenkbuch der Kriegsgräberstätte verzeichnet. Sie können gern einen Auszug bei uns bestellen.
- Bitte beachten Sie, dass auf einigen Friedhöfen nicht die aktuelle Version ausliegt, somit kann der Name Ihres Angehörigen darin evtl. noch nicht verzeichnet sein.
- Falls Johann Reb mit Ihnen verwandt ist, und Sie von uns über Sachstandsänderungen informiert werden möchten, füllen Sie bitte das folgende Formular aus.
- Bitte prüfen Sie vorher an Hand Ihrer Unterlagen sorgfältig, ob es sich wirklich um Ihren Angehörigen handelt. Falls Sie nicht sicher sind, vermerken Sie dies im Textfeld des Formulares.
Kurzbiographie

Portrait Johann Rebs mit Parteiabzeichen der NSDAP, ca. 1935
Johann, genannt Hans, Reb (Reeb) wurde am 29. April 1913 in Gersweiler bei Saarbrücken als Sohn des Hüttenarbeiters Johann Jakob Reeb und seiner Frau Maria (geb. Fritsch) geboren.
Reb verdingte sich als Hilfsarbeiter und war zwischenzeitlich erwerbslos. 1936 absolvierte er den Reichsarbeitsdienst. Anschließend absolvierte er ab dem 8. August 1936 seinen Wehrdienst bei der 1. Kompanie des Ergänzungs-Bataillons 53. Nach Ablauf der Dienstzeit wurde er am 3. Oktober 1936 als Schütze aus der Wehrmacht entlassen. Wenige Monate später heiratete er am 20. Januar 1937 seine Frau Katharina „Käthe“ Hermann, die er während seiner Zeit beim Reichsarbeitsdienst kennengelernt hatte. Aus der Ehe gingen die Kinder Hans (1937), Margarete (1938) und Gisela (1942) hervor. Die Familie lebte in Meisenheim. In dieser Zeit wurde er wahrscheinlich Mitglied der NSDAP.
Am 26. Oktober 1939 erhielt Reb den Einberufungsbefehl zum 2. Schwadron der Divisions-Aufklärungs-Abteilung 263. Zunächst wurde er zur „Sicherung der Westgrenze“ und anschließend beim Einmarsch in Frankreich und der folgenden Besetzung eingesetzt. Nachdem der Sohn Hans am 20. November 1940 an Diphterie verstarb, wurde Reb zwischenzeitlich vom 31. Oktober 1940 bis zum 31. März 1941 als Rüstungsarbeiter in die Heimat beurlaubt. Danach folgte ein Einsatz in Polen, wo er am 23. Juni 1941 durch einen Granatsplitter eine Verletzung an der rechten Schulter erlitt und ab dem 24. Juni für drei Tage in das Reserve-Lazarett in Warschau kam. Nur wenige Monate nach der Geburt seiner zweiten Tochter Gisela wurde er im Herbst 1942 schließlich zur 3./Panzerjäger-Abteilung 33 nach Nordafrika versetzt. Dort wurde er am 25. Oktober erneut durch einen Granatsplitter – diesmal am Bauch und Rücken – verwundet. Er erlag seinen Verletzungen am darauffolgenden Tag.
Der Oberstabsarzt Dr. Fischer informierte die Ehefrau Johann Rebs darüber, dass ihr Ehemann „am 27.10.1942 auf dem deutschen Ehrenfriedhof in Marsa Matruk (Ägypten) mit militärischen Ehren beigesetzt [worden sei].“ Posthum wurde ihm die Medaille für den italienisch-deutschen Feldzug in Afrika verliehen.
Heute ruht Johann Reb auf der deutschen Kriegsgräberstätte in El Alamein, Gruft 1..
Empfohlene Zitationsweise: Projekt "Kriegsbiographien", Johann Reb, in: Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge e.V., Gräbersuche Online, [Zugriff am].
El Alamein, Ägypten

Die Kriegsgräberstätte El Alamein war eine der ersten deutschen Anlagen überhaupt. Sie ist auch Ruhestätte von 31 toten Soldaten, deren Herkunft unbekannt ist.
Friedhofbeschreibung
An der Küstenstraße zwischen Alexandria und Marsa Matruh, etwa 100 Kilometer westlich von Alexandria, liegt die deutsche Kriegsgräberstätte El Alamein. Sie ist in Form eines Achtecks angelegt und gleicht einer Burg (sogenannte Totenburg). Jede Ecke ist zu einem Turm ausgebildet. Der äußere Durchmesser einschließlich der Türme beträgt 42 Meter, die Höhe des gesamten Bauwerks zwölf Meter. Ähnliche Anlagen hat der Volksbund in Tobruk (Libyen) und auf dem Pordoi (Italien) errichtet.
Das Innere des Baukörpers bildet einen Ehrenhof, um den – ebenso wie in Tobruk – ein Bogengang führt. Zwischen Bogengang und Außenmauer lässt das nach innen vorspringende Mauerwerk der Türme acht Nischen entstehen, von denen eine als Eingangsraum gestaltet ist. Unter den sieben anderen Nischen befinden sich Gruftkammern, in denen die Gefallenen liegen. Oben in den Nischen stehen jeweils Gedenksteine in Sarkophagform. Auf den Rückwänden der Nischen sind die Namen der darunter bestatteten Gefallenen auf Bronzetafeln verzeichnet. Unter dem Eingangsraum sind weitere 31 tote Soldaten bestattet, deren Nationalität unbekannt ist.
Belegung
In El Alamein ruhen insgesamt 4.313 Tote. Darunter sind 4.283 deutsche Gefallene des Zweiten Weltkriegs sowie 30 Tote des Ersten Weltkriegs.
Historie
Bereits zwischen 1943 und 1947 betteten Umbettungskommandos der britischen Armee die Gefallenen der Commonwealth-Truppen aus verstreut liegenden Wüstengräbern auf einem neu angelegten Friedhof zusammen. Dorthin wurden auch italienische und deutsche Tote überführt. So entstand eine provisorische Gräberanlage mit 3.000 deutschen und 1.800 italienischen Gefallenen. Sie erhielt den Namen Tell-el-Eyssa und ging 1947 in die Betreuung des amtlichen italienischen Gräberdienstes über.
Ende 1953 gestattete die ägyptische Regierung einer vorher in Libyen tätigen Arbeitsgruppe des Volksbunds Deutsche Kriegsgräberfürsorge, auf ihrem Hoheitsgebiet weitere 1.200 Tote aus verwahrlosten Friedhöfen und Feldgräbern zu bergen. Sie wurden in ein provisorisches Mausoleum neben dem Friedhof Tell-el-Eyssa umgebettet.
Die Kriegsgräberstätte erhielt ihren endgültigen Standort drei Kilometer südöstlich der provisorischen Gräberanlage, nachdem die ägyptische Regierung dafür ein geeignetes Gelände kostenlos zur Verfügung gestellt hatte. Sie gestattete, dass unmittelbar nach der Fertigstellung der Kriegsgräberstätte Tobruk in Libyen im November 1955 die gesamte Baueinrichtung nach Tell-el-Eyssa in Ägypten verlegt werden konnte. Außerdem durfte der Volksbund das für die Errichtung des Baus notwendige Steinmaterial in einem Bruch bei Marsah Matrut gewinnen lassen.
Die Gedenkstätte wurde am 28. Oktober 1959 eingeweiht und als eine der ersten deutschen Anlagen nach dem Zweiten Weltkrieg der Öffentlichkeit übergeben.
Besonderheit
Alle drei Jahre findet eine internationale Gedenkstunde zur Erinnerung an das Ende der Schlacht um El Alamein statt. Die Veranstaltung findet im Wechsel auf dem deutschen, italienischen und britischen Soldatenfriedhof statt.
Derzeit errichtet die ägyptische Regierung rund um die Kriegsstätte eine neue Großstadt (New Elamein), in der rund eine Million Menschen ein neues Zuhause finden soll.
Hinweis für Friedhofsbesucher
Auf einigen Kriegsgräberstätten, die der Volksbund in Osteuropa errichtet hat, ist die Namenkennzeichnung teilweise noch nicht erfolgt! Daher bitten wir dringend darum, dass sich Angehörige vor einer geplanten Reise mit uns unter der E-Mail-Adresse service@volksbund.de oder der Telefon-Nummer +49(0)561-7009-0 in Verbindung setzen. So können wir auch gewährleisten, dass die jeweilige Kriegsgräberstätte zum geplanten Besuchstermin geöffnet ist.
Mediathek
-
Informationstafel El Alamein in ÄgyptenMediathek
Lesen Sie mehr über den Kriegsgräberdienst und über die Volksbund-Arbeit allgemein.